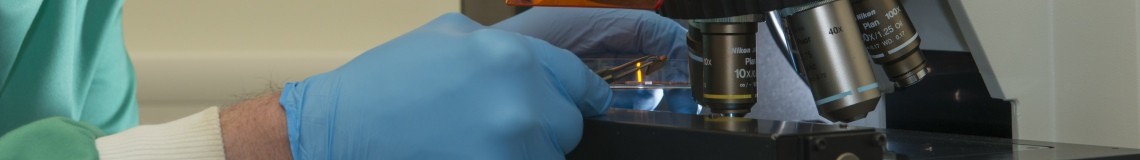Nach Annahme der Wissenschaft gibt es verschiedene Möglichkeiten wie antimikrobielle Kupferwerkstoffe pathogene Keime eliminieren können.
Der Mechanismus, durch den antimikrobielle Kupferwerkstoffe Keime verringern, ist komplex, die Wirkung hingegen simpel.
Kupfer und Kupferlegierungen besitzen antimikrobielle Eigenschaften sowohl gegen Gram-positive wie Gram-negative Bakterien, auch ‚contact killing’ genannt. Der Mechanismus, wie Kupferoberflächen Keime final zerstören, konnte zum Großteil erst im Jahr 2013 aufgeklärt werden. Im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts „Kupfer antimikrobiell – Materialien, Verfahren, Biologie“ erarbeiteten Materialwissenschaftler und Biochemiker der Universität des Saarlandes und der Universität Bern ein erweitertes Grundlagenverständnis antimikrobieller Effekte durch Gestaltung spezifischer Material- und Oberflächenparameter von Kupferwerkstoffen zur Untersuchung ihrer Bedeutung für die Interaktion zwischen Werkstoff und Mikroorganismus.
Mindestens vier verschiedene Erklärungsmuster werden derzeit weltweit von Wissenschaftlern untersucht:
· Kupfer bewirkt, dass Kalium oder Glutamat durch die Außenmembran von Bakterien austritt
· Kupfer stört das osmotische Gleichgewicht
· Kupfer bindet sich an Proteine, die kein Kupfer benötigen
· Kupfer verursacht oxidativen Stress, indem es Wasserstoffperoxid erzeugt
Fakt ist, dass sich im Inneren von inaktivierten Bakterien unter dem Elektronenmikroskop Kupferionen nachweisen lassen. Wie das Kupfer ins Innere der Zellen gelangt, ist noch unklar, ebenso, wie der zerstörerische Prozess bei Bakterien ausgelöst wird. In Laborversuchen bewies das Forscher-Team, dass Bakterien nur dann verenden, wenn diese in direktem Kontakt mit der Kupferoberfläche stehen. Einzelne Kupferionen in einer Flüssigkeit reichen dafür oft nicht aus. Für die Forschungen wurde die Laserinterferenztechnologie am Steinbeis-Forschungszentrum für Werkstofftechnik (MECS) in Saarbrücken genutzt. Eine Kupferplatte wurde mit einer dünnen Kunststoffschicht überzogen. Mit pulsierenden Laserstrahlen schossen die Materialforscher winzige Löcher in diese Schicht und erzeugten so ein wabenartiges Muster. Die Löcher waren mit einem halben Mikrometer, einem millionstel Meter, kleiner als der Durchmesser der Bakterien. Überraschenderweise sind die Bakterien auf dieser Oberfläche nicht zerstört worden, obwohl Kupferionen freigesetzt wurden. Im Vergleichsversuch mit einer unbeschichteten Kupferplatte und der gleichen Konzentration von Kupferionen waren hingegen alle Bakterien nach wenigen Stunden vernichtet. Dies zeigt, dass Bakterien vor allem beim direkten Kontakt mit der Kupferoberfläche final inhibiert werden. Offenbar wird dadurch erst die Zellhülle angegriffen und so die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Kupferionen die Zellen völlig zerstören können. Dies lässt weitergehend vermuten, dass komplexe elektrochemische Prozesse zwischen Kupferplatte und Keimen auf der Oberfläche eine wichtige Rolle spielen.
Die nachstehenden Fragen und Antworten fassen nochmals die bisherigen Erkenntnisse der Forschung zusammen, die versucht, die Funktionsweise zu erklären, die Antimicrobial Copper zum wirksamsten Material für Kontaktoberflächen macht.
Wie inaktiviert Kupfer Bakterien?
Die Wissenschaft nimmt an, dass Kupferwerkstoffe in zwei Schritten vorgehen, um Keime zu zerstören: Der erste Schritt ist die direkte Wechselwirkung zwischen der massiven Oberfläche und der Außenmembran der Keime. Dieser Kontakt führt dazu, dass in der Membran Risse entstehen. Der zweite Schritt zielt auf diese Risse in der Außenmembran ab, durch die die Zelle lebenswichtige Nährstoffe und Wasser verliert, wodurch sie allgemein geschwächt wird.
Wie bringt Kupfer die Membran der Bakterien dazu, zu reißen?
Die Außenmembran jeder Zelle, auch von einzelligen Organismen wie Bakterien, ist durch einen stabilen elektrischen Mikrostrom gekennzeichnet. Dieser Strom wird häufig als "Transmembranpotenzial" bezeichnet und ist der Spannungsunterschied zwischen dem Inneren und Äußeren einer Zelle. Man vermutet, dass es beim Kontakt eines Bakteriums mit einer Kupferoberfläche zu einem Kurzschluss in der Zellmembran kommt. Dadurch wird die Membran geschwächt und rissig.
Eine andere Möglichkeit, um ein Loch in einer Membran zu verursachen, ist lokalisiertes Oxidieren oder "Rosten". Dies geschieht, wenn ein einzelnes Kupfermolekül oder Kupferion aus der Kupferoberfläche freigesetzt wird und auf einen Baustein der Zellmembran (Protein oder Fettsäure) trifft. Wenn dieses Aufeinandertreffen in Gegenwart von Sauerstoff erfolgt, sprechen wir von einem "oxidativen Schaden" oder "Rost". Eine Analogie ist Rost, der ein Stück Metall schwächt und schließlich Löcher hineinfrisst.
Wie beeinflussen Kupferionen die Zelle weiter, nachdem Risse in der Membran entstanden sind?
Nachdem der Hauptverteidigungswall der Zelle (ihre äußere Hülle) geschwächt ist, können Kupferionen ungehindert in die Zelle eindringen. Dieser Vorgang beeinflusst mehrere lebenswichtige Prozesse im Innern der Zelle. Das Kupfer überwältigt die Zelle regelrecht und zerstört den Zellmetabolismus (d. h. die lebenswichtigen biochemischen Reaktionen). Diese Reaktionen werden durch Enzyme erreicht und katalysiert. Wenn sich überschüssiges Kupfer an diese Enzyme bindet, stellen diese ihre Aktivität ein. Das Bakterium kann nicht mehr "atmen", "essen", "verdauen" oder "Energie erzeugen".
Wie kann Kupfer so schnell und gegen so viele verschiedene Mikroorganismen wirksam sein?
Experten, die sich mit dem Kupfer-Stoffwechsel der Bakterien befassen, erklären die enorme Geschwindigkeit der Interaktion Kupferoberfläche-Bakterium (oftmals werden Bakterien innerhalb weniger Minuten inaktiviert) mit einer zeitgleichen Wirkung des Kupfers auf verschiedene Zellmoleküle ("Multi-Target"). Nachdem die Zellmembran aufgebrochen wurde, kann Kupfer jedwedes Enzym außer Kraft setzen, dem es begegnet. Somit wird der Zelle jede Möglichkeit des internen Nährstofftransportes, der Zell-Reparatur oder der Vermehrung genommen.
Diese "Mehrfachfunktionalität" des Kupfers wird zugleich als Ursache für die enorme Breitbandwirkung des Kupfers interpretiert. In der Tat verloren alle Mikroorganismen, die bislang hinsichtlich der beschriebenen Effekte untersucht worden waren, ihre Überlebensfähigkeit.
Kupfer und Kupferlegierungen sind Werkstoffe, die langlebig, farbig und recyclingfähig sind, und in einer Vielzahl von Produktformen, die sich für eine Reihe von Fertigungszwecken eignen, weit verbreitet sind. Kupfer und seine Legierungen bieten zahlreiche Möglichkeiten für Designer funktionale, nachhaltige und kostengünstige Produkte herzustellen.
Einige spezifische Kupferlegierungen haben intrinsische antimikrobielle Eigenschaften (so genanntes "Antimicrobial Copper"). Produkte aus diesen Materialien haben einen zusätzlichen, sekundären Vorteil, einen Beitrag zum hygienischem Design zu leisten. Produkte aus Antimicrobial Copper sind eine Ergänzung und niemals ein Ersatz für herkömmliche Standardhygienemaßnahmen zur Infektionskontrolle. Es ist wichtig, dass die üblichen Hygienepraktiken fortgesetzt werden, einschließlich derjenigen, die mit der Reinigung und Desinfektion von patientennahen Oberflächen zusammenhängen.